Liebe KollegInnen,
im Protokoll der letzten MV fand sich eine Passage, die bei mir mehr als ein Stirnrunzeln ausgelöst hat. Es geht um eine Abstimmung, an der sich laut Protokoll 23 Personen beteiligt haben. Wenn ich den abgestimmten Sachverhalt als Hinweis auf den konzeptionellen Standpunkt der DGGO nehme, dann muss ich sagen, dass ich eine deutlich konträre Position einnehme. Die Abstimmung stellt ein Spezifikum gruppendynamischen Arbeitens auf den Kopf und ersetzt es durch ein konventionelles betriebswirtschaftlich geprägtes Denken.
Worum ging bzw. geht es:
Im Zusammenhang mit der neu einzurichtenden „Klärungsstelle in der DGGO für Mitglieder und deren Kund/innen“ wird mit „Kund/innen“ ein Begriff eingeführt, der im Kontext gruppendynamischen Arbeitens in die Irre führt. Das Bild des Kunden evoziert einen Austauschprozess, in dem von einem Anbieter etwas angeboten wird, ein Produkt, eine Dienstleistung, etc., die von einer anderen Seite erworben wird mittels einer Gegenleistung, in der Regel Geld, um sie nach der Inbesitznahme zu konsumieren. In den klassischen Professionen wiederum, z.B. der des Arztes oder des Rechtsanwaltes, ist dieser Austauschprozess in berufsrechtliche Rahmungen gegossen, die mit entsprechenden Begriffen einhergehen, die Rede ist dann z.B. von Patienten oder Klienten. Bei einer semiprofessionellen Tätigkeit wie der des/der „TrainerIn“ gibt es solche Rahmungen nicht. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass dieser Begriff in einer Weise trivialisiert ist, dass ich ihn heute nur noch mit Bauchgrimmen benütze.
Eine der wenigen Möglichkeiten, die einem gegenüber dieser Trivialisierung zur Verfügung steht, besteht darin, den Begriff einzubetten in die spezifische Lehr-Lern-Beziehung, die ihm in der Tradition der Gruppendynamik zukommt. Und diese besteht zentral darin, dass der/die Lernende aus ihrem Objektstatus herausgelöst wird und zum Subjekt seines/ihres Lernprozesses gemacht wird. Der/die Trainer ist Co-ProduzentIn dieses Lernens, um sein/ihr Angebot umsetzen zu können ist er/sie auf eine Kooperationsbeziehung angewiesen. Diese zu erarbeiten ist sowohl Voraussetzung wie Ziel gruppendynamischen Arbeitens. Was ich als Trainer weder kann noch will ist, das zu Lernende so zur Verfügung zu stellen, dass es durch einen Kauf Akt von einem Kunden zum anschließenden Gebrauch erworben werden könnte.
Ein Kundenverhältnis erfordert gerade keine Co-Produktion, das macht seine spezifische Effizienz aus. Die beiden Seiten dieses Austauschverhältnisses setzten sich guten Gewissens gegenseitig in den Objektstatus, weil sie wissen, dass dies für beide funktional und entlastend ist. Große Teile unseres gesellschaftlichen Lebens funktionieren deswegen so gut, weil sie sich dieser Tauschlogik unterwerfen. Lernprozesse in der Tradition des Sozialen Lernens jedoch, sei es in Pädagogik, Erwachsenenbildung, Sozialer Arbeit, Psychotherapie, werden in ihrer Substanz durch die Übernahme dieser Logik bedroht.
Zurück zum Protokoll: Interessant und aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist das „Fazit“ der im Protokoll angeführten Diskussion: Die Klärungsstelle gelte „für Klient/innen und Teilnehmer/innen in gruppendynamischen Settings, nicht für andere Angebote der Mitglieder.“ Damit soll wohl deutlich gemacht werden, dass diese neue verbandliche Klärungsstelle des GGO nur für den beruflichen Teil seiner Mitglieder Geltung beansprucht, der in Trainings stattfindet und damit Gegenstand der fachlichen Kompetenz des DGGO ist, und nicht für die gesamte berufliche Praxis. Letzteres wäre auch kaum zu legitimieren. Zugleich wird durch diese Spezifizierung die explizite Einführung des Kundenbegriffs in das Vokabular der Gruppendynamik nochmals bestärkt.
Nun verweist der Antrag von Carl-Otto Velmerig „den Begriff Kund/innen zu ersetzen durch ‚Teilnehmer/innen an gruppendynamischen Veranstaltungen‘“ darauf, dass dieser Begriff bei einigen Mitgliedern durchaus Wiederspruch ausgelöst zu haben scheint. Worin dieser bestand und ob er diskutiert wurde, wird nicht berichtet und vermag ich daher nicht zu sagen, ich war nicht dabei. Da er aber durch eine einfache Abstimmung aus der Welt geschafft wurde, nehme ich an, dass kein Bewusstsein entstand darüber, welch grundlegender konzeptioneller Eingriff hier – quasi nebenbei – vorgenommen wurde. Der Marketingdiskurs und betriebswirtschaftliches Denken, so meine These dazu, haben derart Besitz ergriffen von der intellektuellen Kultur des DGGO, dass die Implikationen von bestimmten Sprach- und Begriffswahlen nur noch vage oder gar nicht mehr bemerkt und verstanden werden.
Um diese These weiter abzuwägen, lohnt es sich, auf das konkrete Abstimmungsverhalten zu schauen: es gab 7 Ja-Stimmen, 8 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen. Was mich beruhigen könnte und gegen die obige These sprechen würde, ist die Tatsache, dass nur 8 von 23 Stimmen explizit gegen diesen Antrag erhoben wurden. Nehme ich diese 8 Stimmen im Umkehrschluss als die Fraktion, die sich des Begriffs des Kunden bedient, dann steht dem eine deutliche Mehrheit von 15 Stimmen gegenüber.
Von diesem 15 bleiben allerdings 8 stumm mit ihrer Enthaltung. Was signalisiert nun wiederum diese Nicht-Meinung? Ein Ich-weiß-nicht-recht-was-ich-denken-soll? Ein Es-lohnt-sich-nicht-dafür-einen-Streit-loszubrechen? Befürchtungen irgendwelcher Art, dadurch in einem bestimmten Licht zu erscheinen und dies nicht zu wollen? Welche latenten Themen wurden hier mitverhandelt? Hat Konformitätsdruck eine Rolle gespielt und falls ja, Konformität wem oder was gegenüber?
Nochmals zur Bestätigung meiner Anfangsthese trägt für mich dabei die Tatsache bei, dass die Rede vom „Kunden“ sich nun ausgerechnet im Kontext der Einrichtung einer Klärungsstelle und dem damit verbundenen Ethikdiskurs einschleicht. Ethikdiskurs und Marketing reichen sich – metaphorisch gesprochen – die Hände, dies ein Phänomen, das allenthalben gesellschaftlich zu beobachten ist. Es entsteht eine Aufrüstung der Schauseite von Organisationen mit dem Mitteln der Moral, in diesem unseren Fall also eine Art gruppendynamisches „Greenwashing“.
Abschließend möchte ich an dieser Stelle daher für mich konstatieren: Da ich nach meinem Verständnis keine Kunden habe, kann ich der im Antrag aufgeführten „Verpflichtung“ an „Alle Mitglieder der DGGO… ihre Kund/innen an geeignetem Ort (beispielsweise eigene Website, Vertrag, AGB) auf diese Möglichkeit hinzuweisen“ nicht nachkommen. Als nicht mehr trainierender Trainer werde ich meine KlientInnen und KooperationspartnerInnen bei Empfehlungen zu Trainings allerdings darauf hinweisen, dass ich von gruppendynamische Angeboten, die sich allzu vollmundig des Begriffs des Kunden bedienen, abrate und dies auch fachlich begründen, wie ich das hier in aller Kürze zu tun versucht habe.
Oliver König im Dezember 2021
"Gruppendynamisches Greenwashing"?
Lieber Oliver König,
vielen Dank für diesen luziden Beitrag. Den Fragen von Thomas Vogl will ich keine weiteren hinzufügen, aber doch dem Verdacht entgegentreten, dass Marketingüberlegungen zur Einrichtung der Klärungsstelle geführt hätten.
An der anderthalbjährigen Vorbereitung unseres Beschlusses haben sich in engagierter Fachlichkeit viele Kolleg/innen beteiligt, die tatsächlich ethisch motiviert ihren Teilnehmer/innen so eine Klärungsstelle anbieten wollen und das erarbeitete Verfahren als einen Beitrag zur schon lange diskutierten Qualitätssicherung der Trainingsangebote sehen. Die Standards von Verbänden mit vergleichbaren Angeboten legten das auch nahe. Einen Impuls gab zudem der schon länger geführte informelle Austausch über Situationen in Trainings, die von Kolleg/innen als unangemessen empfunden werden. Es geht um Interventionsstile und auch um die Gestaltung der Arbeitsbeziehung mit Trainer/innen in Ausbildung.
Soweit diese selbst davon betroffen sind, scheint eine Klärung in der Staffarbeit oft schwierig zu sein oder wird sogar für unmöglich erachtet, was mit vorhandenen Abhängigkeiten begründet wird. Doch auch in die Ausbildungskonferenz oder interne Fachtagungen werden diese Irritationen nicht formell eingebracht, denn ohne kodifizierte Normen mag sich wohl niemand auf die Dynamik von Auseinandersetzungen einlassen, die zu persönlichen Kränkungen führen könnten oder darin ihre Ursache haben – so jedenfalls meine Situationsinterpretation in dem Bemühen, nicht einfach fehlende Courage zu unterstellen. Ich verstehe die Einrichtung der Klärungsstelle als einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der DGGO von einer Kollegenschaft hin zu einer Organisation, in der es formale Wege der Beschwerdeführung gibt.
Die in Frage stehende Abstimmung auf unserer letzten Mitgliederversammlung erinnere aus meiner Perspektive vom Vorstandstisch so: Es gab die Beschlussvorlage im Ergebnis eben jenes Diskussionsprozesses, in den einzusteigen allen Mitgliedern jederzeit möglich war und über den fortlaufend schriftlich und in online-Veranstaltungen informiert worden ist; am Tag zuvor gab es die Gelegenheit zu Beratungen, Klärungen und auch für Änderungsvorschläge. Keine Frage, dass dann abschließend bei der satzungsgemäßen Beschlussfassung diese wichtige Entscheidung zeremoniell gewürdigt werden muss, wozu gehört, dass neben den Antragstellern statushohe Mitglieder zu Wort kommen oder auch solche, die sich noch um einen angemessenen Platz auf der sozialen Rangskala bemühen (was die Versammlungsteilnehmer allerdings zu ermüden begann).
Keine Frage, dass auch nach der langen Vorbereitung die zuletzt noch verbliebenen Unklarheiten sowie Strittiges zur Sprache gebracht werden müssen. Wäre das im Falle Kunden vs. Teilnehmer pointiert mit dem passenden Nachdruck eingebracht worden, hätte das (bei mir) wohl die angemessene Aufmerksamkeit gefunden. Aber so, wie die Dinge gelaufen sind, verpuffte der Einwand im Windschatten wenig bedeutsamer Einlassungen wie eine Nachintervention.
Von den angesprochenen Vermutungen, was die Dynamik des Abstimmungsverhaltens ausgemacht haben mag, war es somit am ehesten „Konformitätsdruck“ – angesichts der allgemeinen Erschöpfung als Ausdruck kollegialen Vertrauens zu denjenigen, die erkennbar gewissenhaft fachlich kompetente Arbeit geleistet haben.
Soweit mein Rückblick auf den Prozess, in dem sich die Arbeits- und Entwicklungsfähigkeit der DGGO eindrücklich gezeigt hat, wie ich meine. Wir haben in der Mitgliederversammlung vereinbart, dass das jetzt formulierte Procedere erprobt und auf Grundlage der zu gewinnenden Erfahrungen ggf. neu diskutiert und weiterentwickelt werden soll. Auch das Thema Kundinnen vs. Klientinnen steht somit zur Disposition.
Mit den besten Grüßen, Enrico Troebst
Ein Versuch zu antworten
Lieber Herr Vogl,
danke, dass Sie mich nochmals zu einer weiteren Klärung auffordern. Zuerst: Ich rede hier nicht vorrangig von Wertentscheidungen, sondern von fachlichen Fragestellungen bei der Unterscheidung von verschiedenen Beziehungsmodalitäten, wie sie von den jeweiligen Kontexten mitbestimmt sind. Die Wertentscheidungen kommen natürlich irgendwann auch dazu, das ist hier aber nicht mein zentraler Punkt.
Natürlich ist die Rahmung gruppendynamischer Arbeit immer auch eine ökonomische, insofern handelt es sich um eine Dienstleistung. Aber auch hier gibt es unterschiedliche Modalitäten, die zu unterschiedlichen Beziehungskonstellationen führen. So sind z.B. bestimmte Leistungen in unserer Gesellschaft aus dem Marktgeschehen herausgenommen, insbesondere ein großer Teil von Bildung und Ausbildung, und dies sozialpolitisch und gesellschaftspolitisch ganz bewusst und gewollt. Nur ein kleinerer Teil ist auf dem Markt platziert. Hier, dies nur nebenbei, liegt aus meiner Sicht einer der Kardinalfehler der frühen Gruppendynamiker, dass sie sich vorrangig auf diesen Markt hin ausgerichtet haben, anstatt, zumindest parallel, für Institutionalisierungsprozesse zu sorgen, so dass gruppendynamische Fortbildungen auch für diejenigen zur Verfügung stehen, die nicht auf diesem Markt unterwegs sind, auch weil sie mit dessen Bedingungen nicht mithalten können.
Die Substanz sozialen Lernens besteht auch nicht an erster Stelle aus Zielen, sondern aus Wegen. Diese sind es, die mir mit der Rede vom Kunden nicht kompatibel erscheinen. Solange Teilnehmer*innen im Training im Modus des Kunden verweilen, haben sie das Lernangebot noch nicht annehmen können. Was Sie über die Verfügbarkeit auf Zeit schreiben, da kann ich gut mitgehen. Die damit verbundenen Paradoxien, die gleichermaßen für alle helfenden und bildenden Berufe gelten, wenn auch in je spezifischer Form, wären hier zu erörtern. Die Arbeit als Werbetexter damit quasi gleich zu setzen, geht dann wieder den entgegengesetzten Weg einer fehlenden Differenzierung von beruflichen Rollen. Deutlich wird dies aus meiner Sicht auch nochmals bei ihren Bemerkungen zum Kunden-Begriff bei Behörden, der den Begriff eines Klienten, verstanden als abhängig und hilfsbedürftig, ablösen soll.
Behörden kommen nun (mindestens) zwei unterschiedliche Funktionen zu, die beide durch den Kundenbegriff eher vernebelt werden. Zum einen sind wir Bürger eines Staates, die von dessen Institutionen bestimmte Dienstleistungen erwarten, die Ausstellung eines Passes z.B. Wir sind von dieser Dienstleistung auch abhängig, da der Staat darauf ein Monopol hat. Als Bürger sind wir keine Kunden des Staates, sondern haben gewisse bürgerliche Rechte, zu denen die Zurverfügungstellung dieser Dienstleistungen gehört. Die Rede vom Kundencenter ist daher vor allem als alltagssprachliche Aufforderung an die Mitarbeiter von Behörden zu verstehen, sich im Dienst der Bürger zu sehen und nicht als Gatekeeper zu Leistungen des Staates, die vor den Bürgern zu schützen sind.
Nochmals deutlicher wird dies zum anderen bei der Funktion von Behörden in der Verteilung von sozialen Leistungen. Der Kundenbegriff schlägt hier noch deutlicher ins Ideologische um, weil er das Grundverhältnis der bestehenden Abhängigkeit verleugnet und zum Verschwinden zu bringen versucht. Der Arbeitslose ist kein Kunde, sondern er ist eben abhängig. Die besondere Aufgabe besteht darin, aus dieser Abhängigkeit herauszuführen, und nicht sie sprachlich zum Verschwinden zu bringen. Diese Grundstruktur gilt ähnlich auch für die helfenden und bildenden Berufe. Mein Anspruch an die Gruppendynamik und diejenigen, die sie betreiben, ist nun die, dass sie sich über die Ausdifferenzierung sozialer Beziehungen, auch in ihrer Beeinflussung durch ökonomische Faktoren, im Klaren sind, und diese nicht hinter einer Wortfassade wie der des Kunden zum Verschwinden bringen.
Interessant ist für mich daher, dass Sie mit keinem Wort auf den weiteren Verlauf meiner Argumentation bzw. auf meine Thesen eingehen, wie die Einführung des Kundenbegriffs verhandelt wurde, nämlich anscheinend gar nicht. Und hier ist es eben schon aufschlussreich, dass ausgerechnet im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Ethikstelle dieses Vokabular Eingang findet, und dies zudem noch bei einem Fach- und nicht bei einem Berufsverband. Das man dies auch anders machen kann, können Sie z.B. beim DGSv nachlesen, der ebenfalls solche Ethikrichtlinien hat. Und obwohl wir es hier mit einem Fach- und Berufsverband zu tun haben, ist hier von Auftraggebern, und an keiner Stelle von Kunden die Rede.
Oliver König
Eine Antwort und ein Kommentar vom Spielfeldrand
Lieber Enrico Troebst,
haben Sie herzlichen Dank für diese ebenfalls luzide Beschreibung des Prozesses. Zur Richtigstellung: ich wollte nicht unterstellen, dass Marketingüberlegungen zur Einrichtungen der Klärungsstelle geführt hätten, sondern eher, dass diese sich, quasi in letzter Minute und wahrscheinlich auch ohne dass sich die Beteiligten darüber bewusst waren, eingeschlichen haben, weil ein bestimmtes Vokabular, von mir als betriebswirtschaftlich bezeichnet, und das damit verbundene Denken den derzeitigen Fachdiskurs durchdringen, ohne dass die Konsequenzen so richtig bewusst wären. Nachdem ich Ihre Ausführungen gelesen habe, denke ich, war es auch einfach Erschöpfung und irgendwann muss man so etwas dann auch einfach beschließen, bevor es durch die Diskussionsmühle restlos zermahlen wird.
Auch haben Sie natürlich Recht, dass ich mich hätte an der Diskussion beteiligen können, anstatt vom Spielfeldrand im Nachhinein hineinzurufen. Ich hatte daher meine Kommentare zur Klärungsstelle, die in einer ersten Version enthalten waren, wieder herausgenommen, um den Beitrag auf den Begriff des „Kunden“ zu konzentrieren. Da wir nun aber die Diskussion begonnen haben, geben Sie mir die Gelegenheit, doch noch meine Kommentare einzubringen. Ich schrieb:
Die Probleme, die im Antrag zur Klärungskommission aufgeführt werden, begleiten die verbandliche Gruppendynamik, seit ich Mitglied bin. Eine Handhabe damit, auch wenn es ein offenes Geheimnis war, um wen es gerade ging, wurde nie gefunden. Die Sektion Gruppendynamik, der Vorläufer der DGGO, war zu Beginn meiner Zeit in der Sektionsleitung in den 1990er Jahren aufgrund gleichfalls moralisch aufgeladener Konflikte derart zerstritten, dass sie kurz vor dem Kollaps stand. Diese Kultur hat sich seitdem deutlich verändert.
Es ist daher eine interessante Frage, wie die innerverbandliche Kontrollaufgaben, die sich mit dieser Klärungsstelle in letzter Konsequenz ergeben, wahrgenommen werden sollen. Im Antrag heißt es dazu: „Eventuelle Sanktionen verhängt der Vorstand“. Welche sollen das sein? Verwarnungen, Geldstrafen, Herstellung von Öffentlichkeit, (begrenzter) Entzug der Ausbildungsberechtigung, Ausschlussverfahren?
Ich selber habe schon die interessante Erfahrung gemacht, Gegenstand einer (sexualisierten) Gerüchteküche zu werden. Wenn die Kommission hier eine andere Kultur zu schaffen in der Lage ist, wäre das durchaus zu begrüßen. Da ich an der Diskussion um die Ethikkommission nicht teilgenommen habe und mir die Mühe vorstellen kann, die sich die Mitglieder des Kreises damit gemacht haben, möchte ich dies nicht bewerten, schon gar nicht abwerten. Ich bin aber gespannt, was hiermit losgetreten wird.
Die Problematik einer solchen Klärungsstelle besteht für mich in der Gefahr, durchaus jenseits aller guten Intentionen, dass konzeptionelle in moralische Fragen verwandelt werden, und dann quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit zwischen einem kleinem Gremium und dem Vorstand verhandelt werden. Es handelt sich hier ja nicht um eine Art ethisch-moralisches Beibrot, sondern um eine Essenz gruppendynamischen Arbeitens. Wenn ein/e Trainer*in das Machtgefälle zu Teilnehmenden ausnutzt - was im Antrag als erstes Beispiel einer Grenzverletzung aufgeführt wird -, dann kann man dies zwar moralisieren, es ist aber an erster Stelle ein fachlich-professionelles Versagen, das von den beteiligten Personen und Instanzen (Staff und Ausbildungsausschuss) nicht bewältigt werden konnte, und nun in eine neue Instanz weitergeschoben wird. Die Möglichkeit zur Supervision, die in die Erläuterungen zur Klärungsstelle aufgenommen wurde, interpretiere ich als Hinweis darauf, dass Sie sich dieser Schwierigkeiten bewusst waren. Ich bin also gespannt auf die erste „Anrufung“ der Kommission.
Mit den besten Grüßen
Von Oliver König
nur noch kurz ein Dank mit einer Korrektur, die DGSv betreffend
Lieber Herr König, vielen Dank für ihre ausführliche Antwort. Vielleicht gehört das bei Gelegenheit auch mal in größerer Runde diskutiert. In der Vorbereitungsgruppe der Klärungsstelle haben wir das Thema durchaus besprochen, waren aber für Ihre kritischen Ansprüche sicher zu schnell damit fertig. Ich glaube, dass die Arbeitsbeziehung zwischen uns und den "Teilnehmenden" verschiedene Aspekte umgreift, die wir nicht alle unter einen Namen kriegen, wahrscheinlich. Außerdem entwickelt sich das ja im Laufe der Arbeit. Wer sich am 1. Tag im Training als "Kunde" fühlt, hat die dort vom Staff angestrebten Kooperations-Normen noch nicht erfasst, was ich ziemlich normal finde. Und wer sich am 5. Tag noch fragt, was er für sein Geld eigentlich von den Trainern oder Trainerinnen bekommt, bei dem ist was schief gelaufen, so viel steht fest. Da sind wir uns einig.
Was die DGSv angeht, sind Sie schwach informiert. Die hat die "Kund*innen" akzeptiert. Zum Beispiel in ihrem Mission Statement (https://www.dgsv.de/dgsv/mission-statement/), im Konzept der Supervision (https://www.dgsv.de/dgsv/supervision/konzept/) und explizit im Zusammenhang mit dem Zweck der Ombudsstelle im Themenbereich "Qualität" (https://www.dgsv.de/dgsv/supervision/qualitaet/). In den ethischen Leitlinien der DGSv heisst es: "Sie bieten Schutz vor eigenen übersteigerten Vorstellungen und überzogenen Erwartungen der Klienten oder Kunden." Das war 2003.
Was ich jetzt besser zu verstehen glaube, ist Ihr ideologiekritischer Impetus. Der Arbeitslose wird als "Kunde" des Arbeitsamtes schlicht verspottet. Das stimmt. Sie wollen sich nicht von neoliberalen BWLern die Erwachsenenbildung und ihre Werte und Wege dominieren lassen. O.K. Das will ich auch nicht. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass zumindest ich keinen ideologischen Begriff vom Kunden habe und wohl auch sonst niemand im Vorbereitungsteam der Klärungsstelle. Da findet aus meiner Sicht gerade keine feindliche Übernahme durch Betriebswirte statt.
Thomas Vogl
- Anmelden oder Registrieren, um Kommentare verfassen zu können

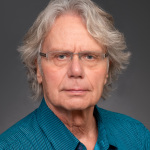
Ein Versuch zu verstehen...
Lieber Herr König, mir ist beim Lesen Ihrer Gedanken noch nicht klar geworden, was genau Sie ärgert. Ich lese, Sie wollen die Substanz sozialen Lernens davor schützen, einer ihr selbst fremden Tauschbeziehung geopfert zu werden. Wenn ich mich frage, was diese Substanz sozialen Lernens sein könnte, habe ich Ideen wie Emanzipation, Selbstbestimmung oder "Reife" im Kopf. Erreichen möchte man solche Entwicklungsfortschritte durch Beziehungsarbeit. Denken Sie auch an so etwas? Das kann man nicht kaufen. Ganz klar. Beziehungen nicht und das Reifen nicht. Beides wird für mein Verständnis aber auch nicht wirklich beschädigt, wenn man "semiprofessionelle Lerngelegenheiten" dafür einkauft oder verkauft. Ich gebe jemandem Geld, damit er/sie mit mir Co-Produktion, Kooperation übt oder trainiert und im günstigen Fall etwas darüber lernt. Dabei mache ich mich als Trainer - auf Zeit - etwas mehr verfügbar als ich es sonst für diese Menschen, die teilnehmen, wohl machen würde. Ich verkaufe sozusagen meine unveräußerliche Beziehungsfähigkeit. Das ist ein wenig paradox. Ja, aber es bleibt ein Tausch mit der Chance auf eine Erfahrung. Die Teilnehmenden sind eben auch Kunden und können beides in der Regel ganz gut unterscheiden, die Teilnahme und den Tausch. Ich arbeite ja auch noch als Werbetexter und da ist es nicht so wahnsinnig viel anders. Wenn die Kundenbeziehung nicht gut trägt, wozu beide Seiten etwas Unverfügbares, Unverkäufliches beitragen müssen, dann wird das Nichts mit der versprochenen kreativen Leistung. Das Besondere im Training ist für mich, dass genau diese Co-Kreation das Thema ist. Es wird explizit gemacht.
Mir scheint auch der Sprachgebrauch nicht so eindeutig zu sein, wie Sie es vielleicht wahrnehmen. Ich erlebe es in Behörden zum Beispiel, dass dort der Wechsel von der Klienten-Denke zur Kunden-Denke direkt angestrebt wird. Der Kunde ist in deren Bild autonom, ein erwachsenes "menschliches" Gegenüber, auf dessen Interessen man bestrebt ist sich sorgfältig einzustellen. Der Klient dagegen ist abhängig, hilfsbedürftig, potentiell ein "Objekt" meiner "Behördenwillkür", meiner Macht als Sozialarbeiter ausgeliefert etc. Ich verstehe meine Trainings als Erwachsenenbildungsmaßnahme. Für mein Gefühl hätte ich gerne Kunden, die sich anmelden. Der Begriff Teilnehmende verschleiert vielleicht eher die Realität, dass ich davon lebe, solche Trainings zu leiten. Das darf ruhig zum Ausdruck kommen, dass manche in der TG zahlen und andere kassieren. Finden Sie nicht? Sind durch so ein Denken die Lernprozesse in meinem Training bedroht? Müssten Sie Interessenten von einem Training bei Thomas Vogl abraten? Wenn ja, dann verstehe ich es noch nicht richtig. Würde das aber gern.
Thomas Vogl